eine straße
von fremden ländern
von den strömen der stadt
b1|a40 die schönheit
der urbane kongress
choreografie e. landschaft
ein ahnungsloser traum
wg/3zi/k/bar
the chain
parcours interdit
mülheimer wunderkammer
uneingelöste versprechen
public garden
local to local
museum f. sed. kunst
stadtraum.org
wildlife
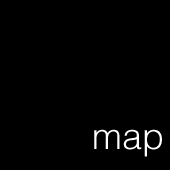
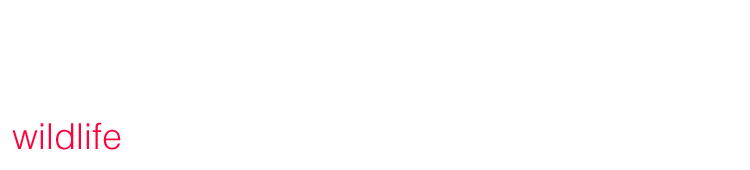
aktuell
termine
publikationen
presse
kontakt
newsletter
markus ambach
arbeiten
texte
vita
kontakt
impressum
Wildlife
Zur Website:
►www.summerpalace.de
wildlife 02.03.04.05 - ein Gartenprojekt von Markus Ambach
Im Sommer 2002 habe ich einen ca. 1200qm großen Garten mitten in der Neusser Innenstadt gemietet. Er zeichnet sich durch alten Baumbestand, eine üppige Vegetation und seine inselhaft entrückte Abgeschlossenheit (ihn umgibt eine unüberschaubare Mauer ringsum, die ihn als typischen hortus conclusus ausweist) mitten in der Stadt (direkt zwischen Hauptbahnhof und Shoppingmeile) aus.
Die Tage dieser außergewöhnlichen Zelle mitten im Stadtkörper waren von Anfang an gezählt: als lukratives Bauland längst verplant harrt sie ihrem Abriss.
Das Projekt war von vorne herein auf 3 Jahre begrenzt. Abgesehen von der Grundstruktur waren alle Eckpunkte, die im folgenden benannt sind, weniger geplant als daß sie sich mit der Dauer des Projekts und meiner selbstgewählten Rolle als Gärtner ergaben und entwickelten.
Ein selbstregulierter Ort
Unverhofft zum Gärtner geworden habe ich dort in den Sommern 2002/2003/2004 mit vielen KollegInnen (ca. 65 KünstlerInnen, Architekten, Filmemachern, Musikern und vielen Gästen) eine Art Sommerbankett der Künstler jenseits herkömmlicher ökonomischer Strategien veranstaltet. Ich habe die Kollegen gebeten, Arbeiten, Konzerte, Vorträge, Essen oder andere Dinge im Garten zu machen, um ihn zu einem Treffpunkt und Gesprächsraum werden zu lassen.
Dabei war zentraler Gedanke, eine kleine, autonome Zelle mitten im Stadtkörper zu öffnen, die weitgehend abgekoppelt ist von den normalen künstlerischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Verwertungszusammenhängen und Wertschöpfungsstrategien, weitgehend frei von den üblichen Hirarchien und Erwartungshaltungen. Es sollte in gewisser Weise ein sich selbstregulierender, autoproduktiver Ort sein - eben ein Garten.
Um die besonderen Bedingungen eines solchen Raumes herzustellen, waren nur wenige, denkbar einfache Grundsätze vonnöten: Zunächst haben wir als Künstler und Produzenten die ganze Sache aus uns selbst heraus gemacht, ohne Förderung jeglicher Art. Bezüglich der Arbeiten gab es von mir aus keinerlei Vorstellungen oder Vorgaben jedweder Art gegenüber den Beteiligten. Es gab insofern weder eine ambitionierte, selbstreferentielle Projektstrategie noch irgendeine kuratorische Tätigkeit, jeder durfte schlicht machen, was er wollte, wann immer er wollte.
Ich selbst habe keine Arbeit gezeigt. Ich war der Gärtner. Als solcher habe ich den Künstlern geholfen, ihre Arbeiten, Konzerte etc. zu realisieren und das Notwendigste organisiert. Auch in dieser Funktion habe ich kein einziges mal in irgendwelche Entscheidungen der Künstler eingegriffen.
Zunächst durften nur die KünstlerInnen und deren Freunde in den Garten, um eine klassische Ausstellungssituation und deren Verwertungszusammenhänge zu vermeiden. Alle Arbeiten sind unter diesen Vorraussetzungen entstanden, auch wenn im 3. und letzten Jahr der Garten mehr und mehr für Interessierte geöffnet wurde.
3 Jahre Fremdkörper in der Stadt: Ferien vom Ich
Die Arbeiten und Aktionen, die im Garten entstanden sind und stattfanden reflektierten diese anderen Bedingungen auf eindrucksvolle Weise. Sie sind weniger als einzelne Statements zu sehen sondern mehr wie eine gemeinsame Beschreibung und Definition dieses spezifischen Gemeinschafts- und Gartenraumes und die Herstellung seiner unikaten Atmosphäre.
Die in dieser von den herkömmlichen ökonomischen Implikationen abgekoppelten Situation entstanden Arbeiten sind für die KünstlerInnen meistens genauso unkonventionell wie bemerkenswert. Bei vielen fällt es schwer oder erscheint redundant, sie bestimmten Künstlerpersönlichkeiten oder deren herkömmlichen Werkstrategien zuzuordnen. Es scheint, als hätten die KünstlerInnen im isolierten, speziellen Klima des Gartens nicht nur ein Höchstmaß an Selbstverantwortung entwickelt sondern sich auch ein Maximum an künstlerischer Freiheit geleistet.
Der Garten kommentiert und beschreibt so als gemeinsam determinierter Raum über sich selbst hinaus in seinem Subtext auch die Verformungen, die sich unter dem alltäglichen ökonomischen Druck des Betriebssystems Kunst bei den Protagonisten einschreiben und zeigt Möglichkeiten auf, diesen zu vermindern oder ihm zu entgehen. Er verweist auf die Chancen, innerhalb der Gesellschaft selbstbestimmte Parzellen oder Einschlüsse anzulegen und temporär zu betreiben.
Dabei blieb das Projekt immer einer angenehmen Einfachheit verpflichtet: auch die beschriebenen Erkenntnisse zeigten sich vor Ort nicht als bemühter Diskurs sondern als angenehme Erfahrungen einer leicht anarchischen Freiheit zwischen Kunstproduktion und Barbecue, Vorlesung und Müßiggang, Diskurs und Schrebergarten, Konzert und Sonnenbad.












